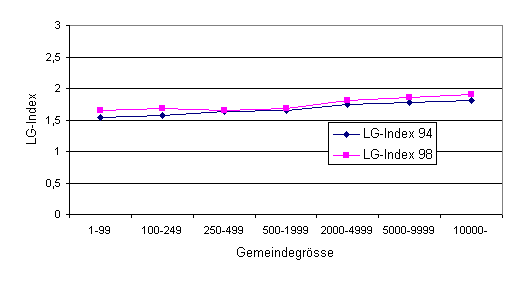
Dr. Andreas Ladner, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern
Schriftliche Fassung des Vortrags
für die 47. Generalversammlung des Schweizerischen Gemeindeverbands vom
16. Juni 2000 im Schützen- und Gesellschaftshaus in Glarus.
Die
Gemeinden waren ursprünglich vor allem für die Nutzung der gemeinsamen
Güter und für die Armenfürsorge verantwortlich. Die Einnahmen
bezogen sie in Form von naturalen Gütern und Frondiensten. Im Laufe der
Zeit sind ihnen immer mehr Aufgaben zugefallen. Neben den Gemeinschaftsdiensten,
wie der Aufrechterhaltung der lokalen öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
der Einwohnerkontrolle, der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
sowie Volkszählungen, sind dies eine ganze Reihe von wichtigen Ver- und
Entsorgungsdiensten (Wasser, Elektrizität, Gas, Kehricht und Abwasser)
sowie der ausgedehnte Bereich der sozialen Wohlfahrt, der Bau und Unterhalt
von Strassen und vereinzelt der Unterhalt eines öffentlichen Verkehrsnetzes,
die Gesundheitsdienste, Bildung, Kultur und Freizeit.
Der starke Ausbau öffentlicher
Einrichtungen und Institutionen (Schulen, Wasserversorgungen, Abwasserreinigungen)
während der Hochkonjunktur in den späten 1950er- und 1960er-Jahren
hat zu einer zunehmenden Bedeutung von Verwaltungs- und Managementtätigkeiten
geführt. Komplexe und immer kostspieligere öffentliche Projekte und
zunehmende Auflagen (Raumplanung, Umweltschutz) führten zu einem gesteigerten
Bedarf an Expertenwissen.
Aber nicht nur die fachlichen,
sondern auch die politischen Anforderungen an die Gemeinden haben in den letzten
Jahren zugenommen. Im Gegensatz zu den Entscheidungsproblemen in der Auf- und
Ausbauphase der Gemeinden stehen in den 1980er- und 1990er-Jahren Fragen zur
Diskussion, die weniger auf einer rein technischen oder sachlichen Ebene als
viel mehr auf der Basis von gesellschaftlichen Wertvorstellungen entschieden
werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es leicht nachvollziehbar, dass
die Schweizer Gemeinden heute an ihre Leistungsgrenzen zu stossen.
Dank der Unterstützung
des Schweizerischen Nationalfonds konnten - das erste Mal am Soziologischen
Institut der Universität Zürich, das zweite Mal am Institut für
Politikwissenschaft der Universität Bern - die Gemeindeschreiberinnen und
Gemeindeschreiber sämtlicher Schweizer Gemeinden in den Jahren 1994 und
1998 schriftlich zu ihrer Belastung durch die verschiedenen Aufgabenbereiche
befragt werden.
Gemäss
ihren Aussagen machen (oder machten) den Gemeinden vor allem die Bereiche Neue
Armut/Fürsorge“ und Arbeitslosigkeit“ zu schaffen (vgl. Tabelle
1). In diesen Bereichen gibt jede dritte Gemeinde an, die Leistungsgrenzen
erreicht zu haben. Beide Bereiche sind allerdings verhältnismässig
stark mit der wirtschaftlichen Konjunkturlage verknüpft und es ist davon
auszugehen, dass der wirtschaftlicher Aufschwung zumindest teilweise für
Entspannung sorgt. Auffallend ist, dass bei der Bewältigung der Arbeitslosigkeit
im Vergleich zu 1994 kein weiterer Anstieg des Anteils an Gemeinden mit Leistungsgrenzen
stattgefunden hat, während sich die Situation bei den Fürsorgefällen
noch etwas verschärft hat. Dies kann darauf hinweisen, dass die Einführung
der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zur Entlastung der Gemeinden
beigetragen hat. Zudem begann sich während der Erhebungsphase auch der
Rückgang der Arbeitslosigkeit bemerkbar zu machen.
Auffallend
ist weiter, dass sich die Probleme, die vor allem zu Beginn der 1990er-Jahre
akut waren, zumindest teilweise stabilisiert haben: Keine Zunahme oder gar eine
gewisse Entlastung hat in den Bereichen Abfall/Entsorgung, Umweltschutz, Raum-
und Zonenplanung und Bewilligung von Baugesuchen stattgefunden, welche noch
vor vier Jahren zu den wichtigsten Problemen der Gemeinden zählten.
Allerdings sind neue Probleme dazugekommen. Verstärkt stossen die Gemeinden vor allem bei der Integration von Ausländern und bei der Betreuung von Asylsuchenden, beim Zivilschutz sowie beim Sport und den Sportanlagen an Leistungsgrenzen.Auffallend sind schliesslich auch die Leistungsgrenzen, was die Gemeindeexekutive anbelangt, wobei die diesbezüglichen Schwierigkeiten sowohl das Auffinden von genügend qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten als auch die Fähigkeit zur politischen Steuerung betreffen.
Tabelle1:Leistungsgrenzen
bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben erreicht oder überschritten,
Gemeinden, die 1994 und 1998 an der Befragung teilgenommen haben
|
Aufgabenbereich
|
Leistungs-grenzen erreicht und überschritten 1994 (in %)
|
Leistungs-grenzen erreicht und überschritten
1998(in
%)
|
Veränderung
|
N**
|
|
|
|
|
|
|
|
Neue Armut/Fürsorgefälle/Vormundschaftsfälle
|
24,5
|
32,4
|
7,9
|
1677
|
|
Unterstützung und Betreuung von Arbeitslosen
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
1670
|
|
Gemeindeexekutive
|
*
|
27,3
|
|
1835
|
|
Betreuung von Asylsuchenden
|
15,4
|
26,6
|
11,2
|
1628
|
|
Zivilschutz
|
13,6
|
24,0
|
10,4
|
1673
|
|
Abfall/Entsorgung
|
25,7
|
23,5
|
-2,2
|
1701
|
|
öffentlicher Verkehr
|
12,7
|
21,8
|
9,1
|
1650
|
|
Raum- und Zonenplanung
|
23,2
|
21,1
|
-2,1
|
1692
|
|
Gemeindepolizeiliche Aufgaben
|
*
|
20,9
|
|
1835
|
|
Gemeindeverwaltung Informatik
|
*
|
20,9
|
|
1835
|
|
Abwasser/Kanalisation
|
17,4
|
20,8
|
3,4
|
1689
|
|
Schulfragen
|
15,3
|
20,6
|
5,3
|
1661
|
|
öffentliche Bauten
|
15,3
|
20,6
|
5,3
|
1680
|
|
Feuerwehr
|
*
|
20,5
|
|
1835
|
|
Landschafts- und Ortsbildschutz
|
17,4
|
20,2
|
2,8
|
1686
|
|
Sport/Sportanlagen
|
10,0
|
20,0
|
10,0
|
1647
|
|
Gemeindeverwaltung: Kanzlei
|
*
|
19,7
|
|
1835
|
|
privater Verkehr
|
11,9
|
19,3
|
7,4
|
1668
|
|
Bewilligung von Baugesuchen
|
21,4
|
19,2
|
-2,2
|
1699
|
|
Unterstützung und Betreuung älterer Personen
|
10,7
|
18,7
|
8,0
|
1687
|
|
Umweltschutz
|
19,4
|
18,7
|
-0,7
|
1686
|
|
Wasserversorgung
|
13,4
|
18,4
|
5,0
|
1668
|
|
Betreuung von Drogenabhängigen
|
14,5
|
18,2
|
3,7
|
1652
|
|
Gemeindeverwaltung: Rechnungswesen
|
*
|
18,2
|
|
1835
|
|
Gemeindeverwaltung: Personalmanagement
|
*
|
17,7
|
|
1835
|
|
Integration von Ausländern
|
7,0
|
17,6
|
10,6
|
1660
|
|
Gemeindeverwaltung: Einwohnerkontrolle
|
*
|
17,4
|
|
1835
|
|
medizinische Versorgung
|
10,0
|
16,4
|
6,4
|
1649
|
|
Jugendfragen
|
5,9
|
15,6
|
9,7
|
1667
|
|
Wirtschaftsförderung
|
9,1
|
14,7
|
5,6
|
1626
|
|
Energieversorgung
|
*
|
13,5
|
|
1835
|
|
kulturelle Veranstaltungen/Kulturfragen
|
6,2
|
11,7
|
5,5
|
1659
|
* Item wurde nicht abgefragt
** Anzahl Gemeinden, die diese
Frage 1994 und 1998 beantwortet haben
Von
Interesse ist, welche Gemeinden an Leistungsgrenzen stossen. In der Regel wird
davon ausgegangen, dass vor allem die kleinen Gemeinden nicht mehr in der Lage
sind, die ihnen zufallenden Aufgaben zu erfüllen. Entsprechend wäre
zu erwarten, dass vor allem die Gemeindeschreiber aus den Kleinstgemeinden angeben,
die Leistungsgrenzen erreicht zu haben. Bekannt ist zudem, dass in den letzten
Jahren auch die Städte, von finanziellen Sorgen geplagt, vermehrt Schwierigkeiten
haben, die wachsende Problemlast (A-Probleme) zu bewältigen. Der Zusammenhang
zwischen dem Ausmass der Leistungsgrenzen und der Gemeindegrösse müsste
sich in Form einer U-Kurve manifestieren: Leistungsgrenzen in kleinen Gemeinden
und in Städten, weniger Probleme in den mittelgrossen Gemeinden.
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist - zumindest bezogen auf die durchschnittliche Einschätzung der Leistungsgrenzen über alle Aufgabenbereiche hinweg (Leistungsgrenzenindex) - von einem U-förmigen Verlauf wenig zu sehen. Allerdings trifft es zu, dass die grossen Gemeinden etwas häufiger an Leistungsgrenzen stossen.
Abbildung1:Leistungsgrenzenindex, nach Gemeindegrösse
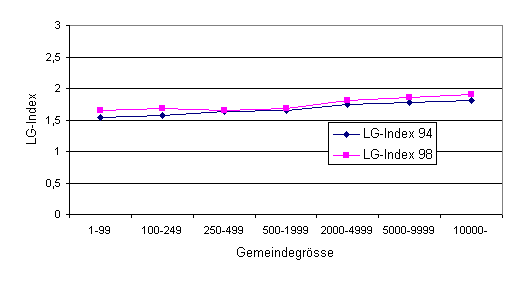
Eine
wichtige Rolle spielen die Finanzen. Die finanzielle Lage der öffentlichen
Hand hat sich in den 1990er-Jahren stark verschlechtert. In besonderem Mass
davon betroffen waren der Bund und die Kantone. Die konsolidierten Finanzhaushalte
aller drei politischen Ebenen verzeichneten beispielsweise 1999 gemäss
Voranschlag einen Ausgabenüberschuss von 7,4 Mrd. Franken. Bei den Gemeinden
belief sich dabei das Defizit lediglich auf 0,5 Mrd. Franken (vgl. EFV 2000a:
Internet). Die Schulden der Schweizer Gemeinden beliefen sich 1999 nach Schätzung
der Eidgenössischen Finanzverwaltung auf 38,8 Mia. Franken bei Gesamtschulden
des Staates von 212,1 Mia. Franken (vgl. EFV 2000b: Internet). Dieser verhältnismässig
geringe Anteil der Gemeinden an der Gesamtschuld darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass zwischen den Gemeinden grosse Unterschiede bestehen.
Stark verschuldet sind vor allem die Städte, während die umliegenden
Gemeinden häufig bei einem deutlich tieferen Steuersatz keine wesentliche
Schuldenlast ausweisen. Insgesamt präsentieren rund zwei Drittel der Gemeinden
im Durchschnitt der letzten drei Jahre ausgeglichene Rechnungsabschlüsse
oder solche mit einem Ertragsüberschuss.
Die wirtschaftlich harten 1990er Jahre haben aber trotz allem auch bei den Gemeinden zu Problemen geführt, wie die Veränderung des realen Ertrags aus Einkommens- und Vermögenssteuern zeigt. Während 1994 noch eine Mehrheit (gegen 90 Prozent) der Gemeinden angab, dass der reale Ertrag zugenommen hat, waren es 1998 nur noch etwas weniger als die Hälfte (vgl. Tabelle 2).
Tabelle2:Veränderung
des realen Ertrags aus der Einkommens- und Vermögenssteuer in den letzten
3 Jahren, Befragungen
von 1994 und 1998 im Vergleich
|
Realer Ertrag aus der Einkommens- und Vermögenssteuer
(nur Gemeinden, die an beiden Befragungen teilgenommen haben) |
||||
|
|
Anzahl 1998
|
In Prozent 1998
|
Anzahl 1994
|
In Prozent 1994
|
|
stark zugenommen
|
30
|
1,8
|
250
|
14,9
|
|
zugenommen
|
756
|
45,1
|
1211
|
72,3
|
|
gleichgeblieben
|
360
|
21,5
|
126
|
7,5
|
|
abgenommen
|
434
|
25,9
|
77
|
4,6
|
|
stark abgenommen
|
96
|
5,7
|
12
|
0,7
|
|
Alle Gemeinden
|
1676
|
100,0
|
1676
|
100,0
|
Für die Mehrheit der Gemeinden kann kaum davon ausgegangen werden, dass die mehr oder weniger befriedigende finanzielle Lage auf kontinuierliche Steuererhöhungen zurückzuführen ist. In jüngster Zeit haben sich die kommunalen Steuerfüsse stabilisiert. 1994 verteilten sich die Gemeinden, in welchen der Steuerfuss gestiegen, gleichgeblieben oder gesunken ist, relativ gleichmässig auf drei Gruppen. Vier Jahre später geben fast zwei Drittel der Gemeinden an, dass der Steuerfuss seit 1994 gleichgeblieben ist (vgl. Tabelle 3).
Tabelle3:Veränderung
des Steuerfusses,
1994 und 1998 im Vergleich
|
Steuerfuss im Vergleich früher
(nur Gemeinden, die an beiden Befragungen teilgenommen haben) |
||||
|
|
Anzahl 1998
|
In Prozent 1998
|
Anzahl 1994
|
In Prozent 1994
|
|
Gestiegen
|
337
|
19,1
|
572
|
32,4
|
|
Gleichgeblieben
|
1114
|
63,2
|
652
|
37,0
|
|
Gesunken
|
312
|
17,7
|
539
|
30,6
|
|
Alle Gemeinden
|
1763
|
100,0
|
1763
|
100,0
|
Durch
die Vielzahl an Gemeinden ist in der Schweiz der Bedarf an Lokalpolitikerinnen
und Lokalpolitikern ausgesprochen gross. In den knapp 3000 Gemeinden finden
sich rund 17500 Mitglieder einer kommunalen Exekutive und rund 17500 kommunale
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Dazu kommt ein Vielfaches an Personen,
die in die verschiedensten Kommissionen Einsitz nehmen, so dass in kleineren
Gemeinden nicht selten ein Fünftel der Stimmberechtigten ein politisches
Amt inne hat. Insgesamt kann gemäss den Angaben der Gemeindeschreiber
davon ausgegangen werden, dass rund 150000 Personen in den Gemeinden ein politisches
Amt ausüben.
Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, steigt die durchschnittliche Anzahl Personen, die in einer Gemeinde ein politische Amt wahrnehmen, von etwas mehr als 15 mit zunehmender Gemeindegrösse auf rund 120 Personen an und geht erst ab 20000 Einwohner wieder leicht zurück. Der durchschnittliche Anteil der Amtsträger an der Einwohnerschaft geht demgegenüber kontinuierlich zurück. In den kleinsten Gemeinden liegt er bei über 10 Prozent, in den grössten Gemeinden beträgt er nicht einmal mehr ein halbes Prozent.
Tabelle4:
Anzahl Amtsinhaber und Anteil Amtsinhaber, nach Gemeindegrösse
|
Gemeindegrösse
|
durchschnittliche
Anzahl Personen mit einem
politischen Amt |
durchschnittlicher
Prozentanteil Amtsinhaber an der
Einwohnerschaft |
antwortende Gemeinden
(N)
|
|
-249
|
16
|
12,5
|
186
|
|
250-499
|
25
|
6,8
|
196
|
|
500-999
|
34
|
4,8
|
269
|
|
1000-1999
|
44
|
3,2
|
308
|
|
2000-4999
|
69
|
2,3
|
296
|
|
5000-9999
|
97
|
1,5
|
106
|
|
10000-19999
|
119
|
0,9
|
56
|
|
20000-
|
105
|
0,3
|
15
|
|
Alle Gemeinden
|
48
|
4,7
|
1432
|
Tabelle 5: Schwierigkeiten
bei der Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindeexekutive
(nur Gemeinden, die 1994 und 1998 an beiden Befragungen teilgenommen haben),
nach Gemeindegrösse
|
Gemeindegrösse
|
1998 in Prozent
|
1994 in Prozent
|
N
|
|
-249
|
60,3
|
61,3
|
300
|
|
250-499
|
63,9
|
61,1
|
288
|
|
500-999
|
69,7
|
68,2
|
337
|
|
1000-1999
|
67,6
|
67,3
|
324
|
|
2000-4999
|
68,1
|
75,9
|
320
|
|
5000-9999
|
69,1
|
68,2
|
110
|
|
10000-19999
|
62,9
|
58,1
|
62
|
|
20000-
|
30,0
|
55,0
|
20
|
|
Alle Gemeinden
|
65,8
|
66,6
|
1761
|
Die Themenbereiche Leistungsgrenzen, Finanzen und Personalangebot zeigen die aktuellen Probleme in den Gemeinden auf. Die Frage ist allerdings, wie dramatisch sich die Situation in den Gemeinden wirklich gestaltet. Die Wissenschaft hat die Aufgabe kritisch zu sein, auch mit ihren eigenen Ergebnissen. Haben die Gemeinden nicht ein Interesse daran, ihre Lage etwas zu übertreiben, um sich beispielsweise vor weiteren Übergriffen des Kantons zu schützen? Fragen wir nach umgekehrt nach der Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsstärke der Gemeinden, so wird das Bild deutlich positiver.
Mehr
als 80 Prozent der Gemeinden schätzen beispielsweise die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke ihrer Gemeinde
hinsichtlich der Kundenfreundlichkeit als hoch oder gar als sehr hoch ein,
und rund 70 Prozent tun dies hinsichtlich der Qualität der Leistungen
(vgl. Abbildung
2). Auch wenn die Gemeindeschreiber bei der Beantwortung
dieser Fragen nicht ganz unbefangen sein mögen, so können diese
Anteile doch als hoch gewertet werden. In eine ganz ähnliche Richtung
deuten übrigens auch Umfragen bei den Bürgerinnen und Bürgern.
So hat beispielsweise eine, allerdings bereits 1993 durchgeführte, Univox-Erhebung
ergeben, dass die Schweizerinnen und Schweizer im Umgang mit der Gemeindeverwaltung
bessere Erfahrungen machen als mit anderen staatlichen Stellen.
Probleme orten die Gemeindeschreiber vor allem bei der finanziellen Situation der Gemeinde: Bei rund 30 Prozent der Gemeinden wird die Leistungsfähigkeit in finanzieller Hinsicht als tief bezeichnet. Allerdings beurteilen auch hier fast 30 Prozent die diesbezügliche Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke ihrer Gemeinde als hoch oder gar sehr hoch.
Abbildung2: Leistungsfähigkeit der eigenen Gemeinde, gemäss Gemeindeschreiber/in
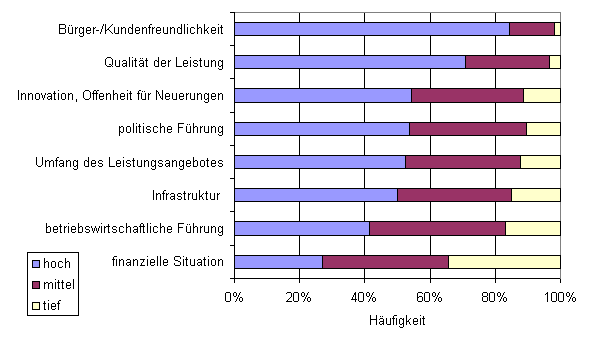
N: 2230 bis 2396
Wie reagieren die Gemeinden auf die steigenden
Anforderungen? In den 1990er Jahren hat in den Schweizer Gemeinden
eine eigentliche Reformbewegung eingesetzt. Neben vielen zahlreichen kleineren
Reformen, die sich vor allem mit dem politischen System der Gemeinde befassen
(Wahlverfahren, Exekutivgrösse, Kompetenzordnung usw.) stehen vier Themenbereiche
im Vordergrund:
- Aufgabenteilung Kanton -
Gemeinden
- Neugestaltung und Intensivierung
der interkommunalen Zusammenarbeit
- Gemeindefusionen
- New Public Management.
Auf die Aufgabenteilung, das
vermutlich zentralste und folgenreichste Unterfangen, werde ich hier nur am
Rande eingehen, weil die Kantone ja nicht vertreten sind. Betrachten wir zuerst
die "kleineren" Reformbestrebungen (vgl. Abbildung 3).
Den Gemeindeschreibern wurde in unserer Befragung eine Liste mit 24 Reformen der politischen und administrativen Organisation der Gemeinde vorgegeben. Gefragt wurde, welche dieser Reformen in den letzten 10 Jahren erfolgreich durchgeführt respektive ohne Erfolg unternommen wurden.
Abbildung 3: Geplante und durchgeführte Reformen in den letzten 10 Jahren
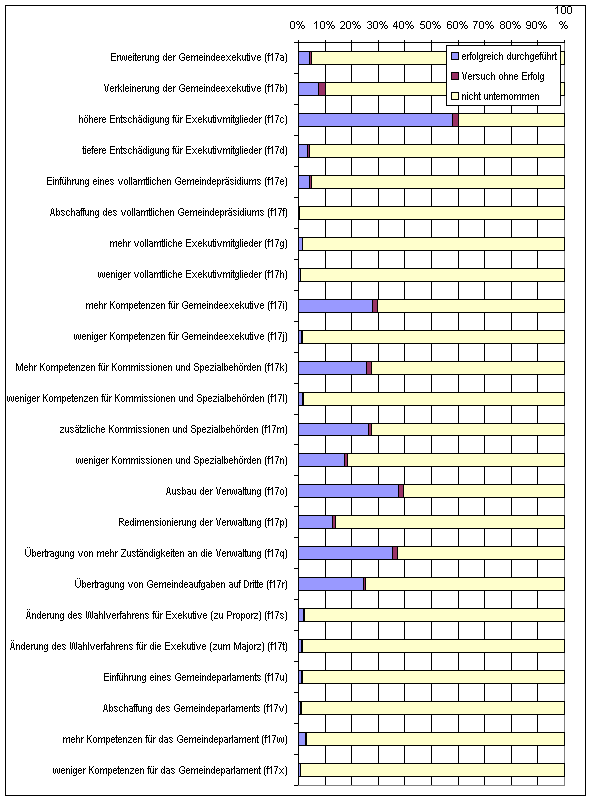
Eine überwiegende Mehrheit
der Gemeinden hat mindestens einen der 24 Reformschritte eingeleitet, lediglich
rund 13 Prozent der Gemeinden (ca. 300 Gemeinden) gaben an, keine dieser Reformen
unternommen zu haben. Im Durchschnitt haben die Gemeinden gegen 3 der aufgeführten
Reformschritte in den letzten 10 Jahren erfolgreich durchgeführt. Auffallend
ist, dass Versuche ohne Erfolg sehr viel seltener sind als erfolgreiche Reformversuche.
Am häufigsten (in mehr als 60 Prozent der Gemeinden) wurde die Entschädigung für die Exekutivmitglieder erhöht. Diese Massnahme ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Anforderungen an die Exekutivmitglieder sowie den steigenden Schwierigkeiten, für diese Ämter geeignete Kandidaten zu finden, durchaus nachvollziehbar. Weitere Reformschritte, die verhältnismässig häufig unternommen wurden, sind: die Erweiterung der Kompetenzen für die Exekutive, die Erweiterung der Kompetenzen für Kommissionen, der Ausbau der Verwaltung, die Übertragung von Kompetenzen an die Verwaltung und die Übertragung von Aufgaben an Dritte.
Umstritten scheint die Zahl der Kommissionen zu sein: Gegen 30 Prozent der Gemeinden geben an, zusätzliche Kommissionen und Spezialbehörden geschaffen zu haben, gegen 20 Prozent geben an, die Zahl reduziert zu haben. Tatsächlich ist auch die Rolle der Kommissionen heute alles andere als unumstritten. Der "schlanke Staat" verzichtet auf ein schwerfälliges und personalintensives Kommissionswesen, während das NPM-Modell neu Kontrollkommissionen einführen will.
Generell kann gesagt werden, dass die Gemeinden mit einer Vereinfachung der Entscheidungsverfahren auf die steigende Aufgabenlast reagiert haben. Als weitere Möglichkeit der Leistungssteigerung erbot sich zudem der Ausbau der Verwaltung und die Übertragung von Aufgaben an Dritte. Reformen des politischen Systems wie beispielsweise die Veränderung des Wahlverfahrens für die Exekutive (Majorz vs. Proporz), die Veränderung der Zahl der Exekutivmitglieder oder die Einführung eines Gemeindeparlamentes machen den kleineren Teil der Reformen aus.
In den 1970er und
1980er Jahren dominierten in den öffentlichen Verwaltungen vor allem punktuelle
Reformvorhaben. Mit dem New Public Management respektive der wirkungsorientierten
Verwaltungsführung zu Beginn der 1990er Jahre wurde erstmals ein Reformpaket
vorgeschlagen, welches das gesamte politisch-administrative System betrifft
und nicht isoliert von kosten-
oder führungstheoretischen Ansätzen ausgeht.
Im Zentrum des NPM-Modells
steht der Prozess der Leistungsvereinbarung. Leistungsempfänger
ist die Bürgerschaft, welche die Leistungen, sei dies über Gebühren,
sei dies über Steuern, selbst finanziert. Eingekauft werden die Leistungen,
gemäss Auftrag der normativen Ebene (Bürgerschaft/Legislative), durch
die Exekutive. Die Exekutive geht mit den einzelnen Direktionen und Fachkommissionen
Leistungsvereinbarungen ein. Diese schliessen dann mit den Leistungserbringern
einen Kontrakt. Leistungserbringer können sein: die Verwaltung, andere
öffentlich-rechtliche Körperschaften oder private Anbieter. Wichtig
ist zudem, dass unter den Leistungserbringern Marktkräfte wirksam werden.
Die Steuerung
verläuft in diesem Modell nicht mehr über den Input, sondern über
den Output. Es werden nicht mehr lediglich Ressourcen zur Verfügung
gestellt, sondern Leistungen eingekauft. Man muss sich entscheiden, welche Leistungen
man benötigt und den entsprechenden Preis dafür bezahlen. Es wird
nicht gefragt, wie viel ist uns das Sozialamt wert? Sondern: Für wie viele
Kinder wollen wir bei welchen Betreuungsverhältnissen und zu welchem Kostendeckungsgrad
Krippenplätze anbieten?
Leistungen werden
über Produkte definiert und gemessen. Produkte können auch
Dienstleistungen sein. Für Produkte lässt sich ein Preis berechnen
(Vollkostenrechnung). Wichtig wird dabei, dass die Leistungskäufer und
die Leistungsfinanzierer kontinuierlich darüber informiert sind, ob die
eingegangenen "Vereinbarungen" eingehalten werden. Mit dem Controlling erhält
das NPM-Modell ein Instrument zur Kontrolle der Leistungserbringung. Möglichst
häufig sollen Informationen in die Entscheidungsgremien zurückfliessen,
welche darüber Aufschluss geben, ob die ausgehandelten Bedingungen eingehalten
werden. Damit auch Marktmechanismen aktiv werden, baut das NPM-Konzept zudem
auf Benchmarking, dem Vergleich mit anderen, vergleichbaren Anbietern
dieser Leistungen.
Ein weiteres wichtiges
Element von NPM ist das Globalbudget, über welches die einzelnen
Ämter verfügen und welches sie auch selbst verwalten können.
Allfällige Überschüsse oder Gewinne werden dabei verteilt und
stehen dem Amt weiter zur Verfügung, so dass bei den einzelnen Stellen
kein Bedarf aufkommt, das ganze Budget jedes Jahr voll auszuschöpfen.
NPM wird in der politischen Diskussion oft als Deregulierungsoffensive
dargestellt, wobei auf die betriebswirtschaftliche Herkunft und auf die Betonung
des Wettbewerbs verwiesen wird. NPM ist aber auch ein Modell, mit dem versucht
wird, die Steuerungs- und Kontrollprobleme des Staates besser in den Griff zu
bekommen. Dort, wo die Aufgaben nicht dem Markt überlassen werden können/sollen,
wird versucht, über die Produkte (output) die Staatstätigkeit zu steuern.
Jedes Produkt hat eine bestimmte Qualität und einen bestimmten Preis. Ob
und in welcher Form es angeboten wird, ist ein politischer Entscheid. NPM impliziert,
dass die Zuständigkeit des Staates überdacht wird und tangiert die
politische Entscheidungsfindung. Ungeklärt ist allerdings noch die folgende
Frage: Führen Vollkostenrechungen und Produktebudgets zu einer Verwesentlichung
der politischen Entscheidungsfindung oder verlagern Globalbudgets und Finanz-
und Entwicklungspläne die Macht hin zu Verwaltung und Exekutive?
Wie stark hat sich NPM in den Schweizer Gemeinden durchgesetzt? Unsere Befragung im Jahr 1998 ergibt, dass sich fast 35 Prozent der Gemeinden schon mit NPM auseinandergesetzt haben, rund ein Viertel plant NPM-Reformen an die Hand zu nehmen. Rund ein Viertel der Schweizer Gemeinden gibt schliesslich an, bereits erste Gehversuche mit NPM unternommen zu haben, wobei dies in besonderem Masse Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern betrifft (vgl.Tabelle 6). Fragt man die Gemeinden jedoch danach, welche NPM-Elemente sie verwirklicht haben, so sind die Ergebnisse weniger spektakulär. Produktedefinitionen, eine Grundvoraussetzung für NPM, haben nur etwa 5 Prozent der Gemeinden vorgenommen, wobei es sich dabei vor allem um die ganz grossen Gemeinden handelt. Ganz ähnlich sieht es auch bei den Leistungsvereinbarungen und bei der Einführung von Globalbudgets aus. Entsprechend ist davon auszugehen, dass bei vielen kleinen Gemeinden bereits bei der Einführung von mit NPM verbundenen Reformen (wie etwa Verbesserung der Kundenfreundlichkeit, Kompetenzdelegation an die Verwaltung und Abschaffung des Beamtenstatus, Einführung einer leistungsabhängigen Entlöhnung, Übertragung von Aufgaben an Dritte und Förderung des Wettbewerbs zwischen externen Anbietern) davon ausgegangen wird, dass NPM betrieben wird. Gerade diese letzten Reformschritte, welche insgesamt deutlich häufiger unternommen wurden, lassen darauf schliessen, dass bis anhin verstärkt Elemente der Deregulierung zur Anwendung gekommen sind, während die im Modell vorhandenen Möglichkeiten zu einer besseren demokratischen Steuerung noch wenig eingesetzt wurden.
Tabelle 6:
NPM und Gemeindegrösse
|
|
erste Gehversuche (NPM) unternommen?
|
Einführung: Produktedefinition
|
Einführung: Leistungsvereinbarungen/Leistungsaufträge
|
Einführung: Globalbudgets
|
N=
|
|
BIS 100
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
143
|
|
101-250
|
4.1
|
0.3
|
0.3
|
0.9
|
323
|
|
251-500
|
12.5
|
0.0
|
2.6
|
2.9
|
420
|
|
501-1000
|
18.5
|
2.2
|
7.1
|
5.5
|
452
|
|
1001-2000
|
26.9
|
4.1
|
9.1
|
7.5
|
386
|
|
2001-5000
|
43.5
|
6.3
|
16.2
|
11.5
|
365
|
|
5001-10000
|
57.4
|
16.0
|
27.5
|
15.3
|
131
|
|
10001-25000
|
59.5
|
31.3
|
47.5
|
31.3
|
80
|
|
25000-
|
95.0
|
50.0
|
65.0
|
65.0
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
24.0
|
4.6
|
9.7
|
7.3
|
2320
|
Interkommunale
Zusammenarbeit
Der zweite grosse Reformbereich umfasst die Kooperation zwischen den Gemeinden, die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ). Sie hat in der Schweiz eine lange Tradition. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden wird nicht nur von den Kantonen (vgl. z.B. BE, LU) als wichtige und vor allem auch als die politisch weniger problematische Reform betrachtet, sondern auch in den Gemeinden selber kommt der IKZ eine wachsende Bedeutung zu. Praktisch zwei Drittel der befragten Gemeinden geben an, die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden habe innerhalb der letzten fünf Jahre zugenommen. Für rund ein Drittel der Gemeinden (36,1 %) ist das Ausmass der Zusammenarbeit gleich geblieben. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Gemeinden (0,6 %) vermeldet eine Abnahme der Zusammenarbeit.
Die klassische Form der interkommunalen Zusammenarbeit ist der Gemeindeverband (Zweckverband). Der Gemeindeverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. In jüngerer Zeit werden jedoch verstärkt auch privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit erprobt. Beispiele interkommunaler Zusammenarbeit finden sich in praktisch allen Sachbereichen. Besonders verbreitet ist sie in den folgenden Bereichen: Schule, medizinische Versorgung, Abwasser/Kanalisation, Abfall/Entsorgung, Zivilschutz, Unterstützung und Betreuung älterer Personen und Wasserversorgung (vgl. Abbildung 4). Hier arbeitet mindestens jede zweite Gemeinde mit einer anderen Gemeinde zusammen.
Bei einigen Aufgabenbereichen wurde die Zusammenarbeit vor allem in jüngster Zeit intensiviert: Bei der Betreuung von Arbeitslosen ist es bei knapp einem Drittel der Gemeinden erst in den letzten fünf Jahren zu einer Zusammenarbeit gekommen. Etwas mehr als 20 Prozent der Gemeinden arbeiten seit jüngerer Zeit im Bereich "Zivilschutz" zusammen und rund 15 Prozent bei der Feuerwehr und im Bereich der medizinischen Versorgung.
Abbildung4: Interkommunale Zusammenarbeit nach Aufgabenbereich
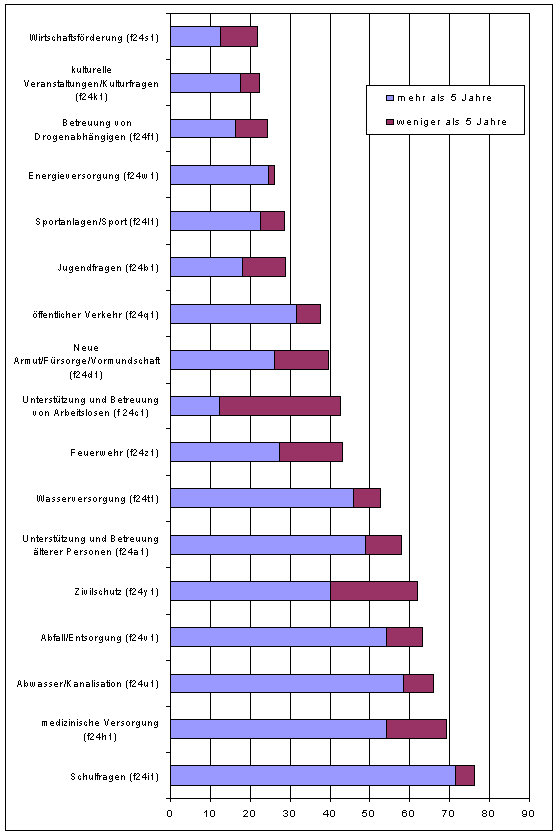
In zahlreichen Aufgabenbereichen besteht ein noch unausgeschöpftes Potential zur Intensivierung der Zusammenarbeit: Weniger als 20 Prozent der Gemeinden arbeiten zusammen in den Bereichen Gemeindeverwaltung (Informatik, Rechnungswesen, Einwohnerkontrolle, Kanzlei, Personalmanagement),gemeindepolizeiliche Aufgaben, Betreuung von Asylsuchenden, Raum- und Zonenplanung, Bewilligung von Baugesuchen, öffentliche Bauten, Landschafts- und Ortsbildschutz, Gemeindebehörde, Umweltschutz, privater Verkehr und Integration von Ausländern.
Bei der IKZ wie übrigens auch bei der Fusion handelt es sich in erster Linie um Probleme der Zuständigkeit. In welchem Perimeter können Aufgaben am besten erbracht werden? In zweiter Linie können daraus allerdings weitere Steuerungs- und Entscheidungsprobleme erwachsen. Das Hauptproblem der IKZ liegt nicht in der Leistungserbringung, hier kann in der Tat davon ausgegangen werden, dass ein Rationalisierungspotential besteht und Skaleneffekte genutzt werden können. Das Hauptproblem liegt im Bereich der Steuerung und der Kontrolle und vor allem der demokratischen Entscheidungsfindung und somit auf der Legitimationsseite. Wie können in einem Verbund von Gemeinden verbindliche Entscheidungen gefällt werden, wenn beispielsweise das demokratische Prinzip "one person, one vote" die kleinen Gemeinden stark benachteiligt, wie können die Gemeinden über ihre Vertreter Einfluss nehmen und wie, im Falle der privatrechtlichen Formen der Zusammenarbeit, müssen solche Verträge abgefasst und die Besitzverhältnisse geregelt werden?
Die
Zusammenlegung von Gemeinden
In der Schweiz hat die Zusammenlegung von Gemeinden keine grosse Tradition. Die grossen Gebietsreformen in den nordeuropäischen Ländern in den 1970er Jahren haben keine Spuren hinterlassen. Erst etwa Mitte der 1990er Jahre ist die Fusion von Gemeinden auch hierzulande ein Thema geworden. Eine führende Rolle spielen dabei:
Vor dem Hintergrund der starren Gemeindestrukturen mag es erstaunen, dass fast ein Fünftel der Gemeinden angibt, schon konkret über den Zusammenschluss mit einer oder mehreren Nachbargemeinden diskutiert zu haben und dass in rund 8 Prozent der Gemeinden konkrete Fusionspläne bestehen. Nicht unerwartet wird vor allem in den vier erwähnten "Pionierkantonen" besonders häufig die Fusion der Gemeinde zu Thema gemacht.
Bei den zur Zeit aktuellen Fusionsdiskussionen geht es in erster Linie um ein Zusammenlegen der unzähligen Kleinstgemeinden. Von Ansätzen einer umfassende Gebietsreform ist kaum etwas zu spüren. Es ist allerdings generell fraglich, wie zukunftstauglich das Konzept der Einwohnergemeinden im herkömmlichen Sinne ist, oder ob sich in Zukunft nicht verstärkt aufgabenspezifische Einheiten mit unterschiedlicher territorialer Ausdehnung herausbilden werden.
Was die verschiedenen grossen Reformbestrebungen (Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, Gemeindezusammenlegungen, New Public Management, Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden) betrifft, so zeigen die Erfahrungen in einzelnen Projekten (vgl. z. B. die Projekte in den Kantonen Bern und Luzern), dass mit punktuellen Vorhaben die Probleme der lokalen Ebene kaum gelöst werden können, respektive dass die verschiedenen Reformbereiche eng miteinander verknüpft sind. Bevor die Aufgaben möglichst effektiv erbracht werden können, muss geklärt werden, wer für die Ausgaben überhaupt zuständig ist und wer davon profitieren soll.
Vieles
erweckt den Eindruck, dass in der Schweiz - mit einer gewissen Verspätung
- dieselben Reformbestrebungen angelaufen sind wie in anderen Ländern.
Die Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Staatsebenen und Gebietsreformen
und Gemeindezusammenlegungen standen in zahlreichen, vor allem nördlicheren
Ländern schon in den 1970er- und 1980er-Jahren zur Diskussion und führten
auch zu neuen Lösungen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass sich
die Ansprüche an die kommunale Ebene in den letzten Jahren gewandelt
haben. Ging es früher in erster Linie darum, die lokale Ebene den Bedürfnissen
eines zusehends interventionistischeren (Zentral-)Staates anzupassen, was
in der Folge vor allem von den Verfechtern der freien Marktwirtschaft kritisiert
wurde, so finden die Reformen heute unter veränderten Bedingungen statt
und werden wohl auch zu anderen Resultaten führen.
Bei
der Aufgabenteilungsdiskussion steht in den 1990er-Jahren zwar nach wie vor
der Anspruch einer optimalen und eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit garantierenden
Steuerung im Vordergrund, man ist sich jedoch sowohl der Gefahr der Übersteuerung
als auch der Vor- und Nachteile von Marktmechanismen bewusster geworden.
Bei
der Diskussion über Gemeindefusionen ist beispielsweise zu bezweifeln,
dass es zu Territorialreformen im grossen Stil kommen wird. Wahrscheinlich liegt
die Zukunft in der verstärkten Zusammenarbeit auf der Basis einer variableren
Geometrie des Staates. Das heisst nicht, dass einzelne Gemeindefusionen nicht
sehr sinnvoll sein können.
Die
Herausforderungen an die traditionelle Staatsorganisation werfen eine Reihe
von zentralen Fragen auf: In welchem Raum soll Politik betrieben werden und
welche Akteure sind daran beteiligt? Wer übernimmt die politische Verantwortung
und wie können verbindliche Entscheide getroffen werden? Zur Zeit beschäftigen
sich die Reformer vor allem mit Zuständigkeitsproblemen respektive mit
der Frage der Steuerung und der Kontrolle. Die für eine demokratische Legitimation
wichtigen Entscheidungs- und Verteilungsprobleme gestalten sich ungleich kontroverser
und bleiben weit gehend ausgeklammert.
In
international vergleichender Perspektive stellt sich die Frage, wie weit die
Schweiz einen Sonderfall darstellt. Während die gesellschaftlichen Ursachen
für den Reformbedarf wohl ähnlich sind wie in anderen Staaten, gibt
es auch distinktiv andere Voraussetzungen: Konsensdemokratie, Direkte Demokratie,
Föderalismus, Gemeindeautonomie, Milizsystem usw. führen dazu, dass
hierzulande die Diskussionen auf einem anderen Niveau stattfinden und teilweise
auch in eine andere Richtung führen.
Während
es beispielsweise in Deutschland darum geht, auf lokaler Ebene neue Partizipationsmöglichkeiten
zu schaffen, sind in der Schweiz die Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen
und Bürger relativ gut ausgebaut, so dass eher eine Verwesentlichung der
Partizipation in den Vordergrund rückt. Die teilweise Abschaffung des fakultativen
Referendums weist etwa in diese Richtung. Auch bei den auf Interessenausgleich
ausgerichteten Verhandlungssystemen (Runde Tische, partizipative Planung, korporatistische
Systeme usw.) steht in der Schweiz nicht deren prinzipielle Einführung
zur Diskussion, sondern es stellt sich vielmehr die Frage, wie mit diesen Instrumenten
umgegangen werden muss, damit die damit verbundenen Nachteile wie Schwerfälligkeit
und tendenzielle Innovationsfeindlichkeit minimiert werden können.
Besonders
deutlich wird die Bedeutung der Ausgangslage bei der Frage der Dezentralisierung.
Während die Reformen in einem zentralisierten Staat wie Frankreich in Richtung
Dezentralisierung laufen, finden in der Schweiz die Auseinandersetzungen auf
einer anderen Ebene statt. Die Revisionen vieler kantonaler Gemeindegesetzgebungen
in den letzten Jahren zeigen, dass die Stärkung der Gemeindeautonomie zwar
nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Bei der Neuordnung der Aufgabenteilung
Kanton-Gemeinden läuft die Tendenz demgegenüber eher in die entgegengesetzte
Richtung. In zahlreichen wichtigen Aufgabenbereichen (Fürsorge, Schule,
Spitalversorgung) wird die Rolle des Kantons gestärkt. Die Schweizer Gemeinden
erhalten zwar mehr Organisationsautonomie (operative Freiheiten), die materielle
und aufgabenspezifische Autonomie geht aber zurück. Der Kanton konzentriert
sich auf das Festlegen der strategischen Rahmenbedingungen, das Motto heisst:
Zentral steuern und finanzieren, lokal handeln.
Dies verdeutlicht schliesslich,
dass die Grundgedanken von NPM auch bei der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden
und der interkommunalen Zusammenarbeit ihre Bedeutung haben. Auch hier stehen
sich auf der einen Seite das Primat der Politik und die Frage nach einer möglichst
effektiven politischen Steuerung und auf der anderen Seite die effiziente Leistungserbringung
gegenüber.
In Moment stellen wir in der Schweiz ein Vielzahl von Reformversuchen fest und es lassen sich noch kaum klare Linien erkennen. Dies muss nicht unbedingt schlecht sein. Eine Stärke der kommunalen Ebene ist die grosse Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Voraussetzungen und beim Erproben von unterschiedlichen Lösungen. Nur so kommt man zu erfolgversprechenden Reform der kommunalen Ebene. Technokratische Lösungen sind nicht nur politisch nicht durchsetzbar, sondern bergen auch die Gefahr, dass sich alle Gemeinden in die falsche Richtung bewegen. Reformfreudige Gemeinden sind zu unterstützen. Von ihren Erfahrungen - den guten und den schlechten - profitieren letztlich alle Gemeinden.